Im Gespräch mit Dina Pomeranz
Dina Pomeranz wurde kürzlich zur UBS Foundation Associate Professor of Applied Microeconomics befördert. Im Gespräch mit ihr werfen wir einen Blick zurück auf ihren akademischen Werdegang.

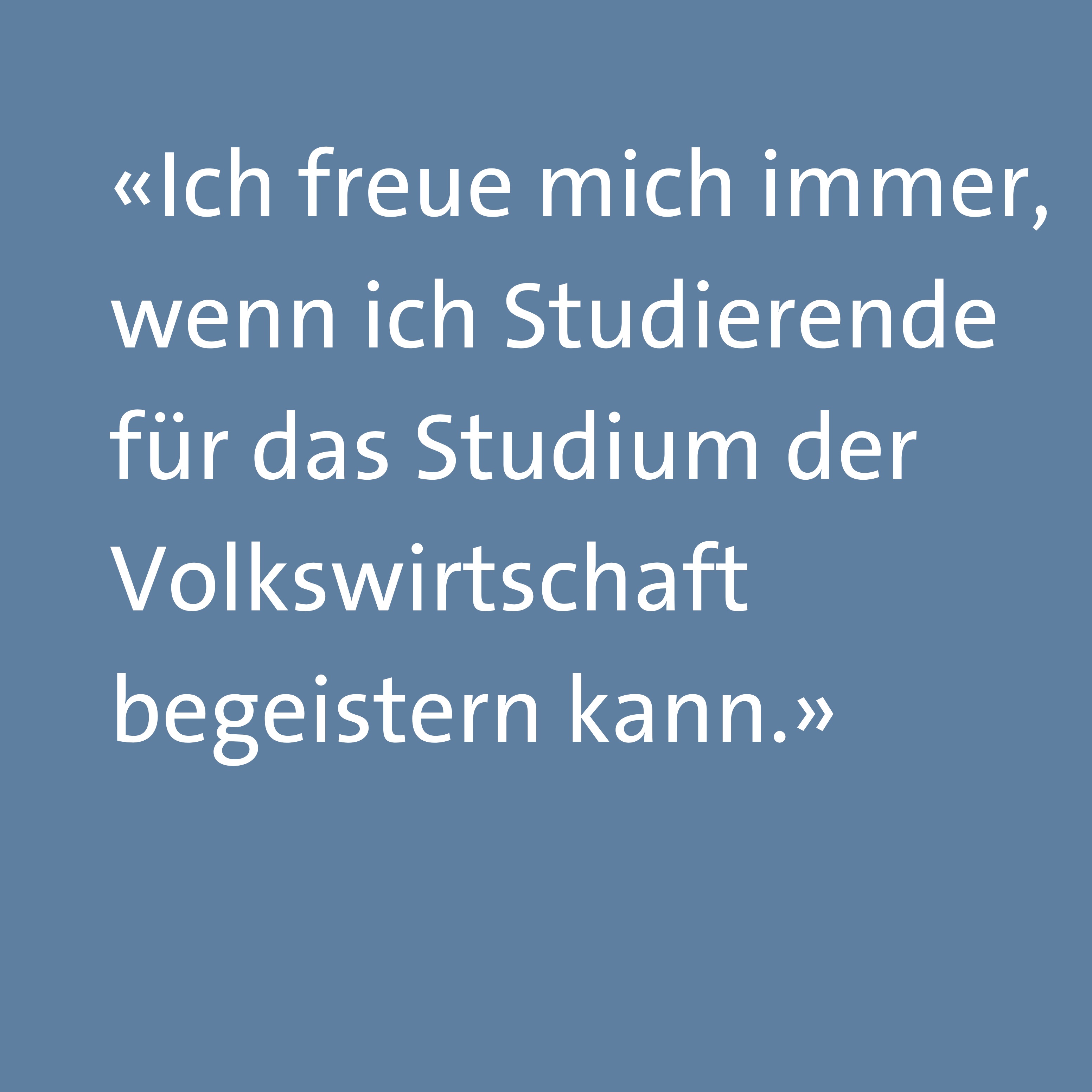
Was motiviert Sie in Ihrer Arbeit als Professorin?
Pomeranz: Ich bin Forscherin geworden, weil ich besser verstehen wollte, warum die Welt so ungleich ist, und was wir dagegen tun können. Ich bin begeistert davon, wie viel die moderne Volkswirtschaftsforschung zu diesen Fragen beitragen kann. Vor dem Doktorat war ich hin- und hergerissen, ob ich anschliessend in die Forschung oder eher in die praktische Policy Arbeit gehen wollte. Doch dann konnte ich feststellen, dass sich beides verbinden lässt. Besonders schätze ich deshalb die enge Forschungszusammenarbeit mit Partnern aus der Praxis. Im Rahmen meiner Forschungsprojekte arbeite ich zum Beispiel mit Regierungen, Steuerbehörden oder Entwicklungsorganisationen in Chile, Ecuador, Kenia, Tansania oder der Demokratischen Republik Kongo zusammen. Durch diese Zusammenarbeit lerne ich sehr viel. Gemeinsam entwickeln wir Forschungsfragen, die sowohl wissenschaftlich fundiert als auch praktisch relevant sind.
Welche Rolle spielt für Sie die Lehre?
Pomeranz: Die Lehre ist ein zentraler Aspekt unserer Arbeit, in welcher wir die Erkenntnisse aus der Forschung mit den Studierenden teilen. Persönlich geniesse ich es sehr, dass ich dadurch mit vielen jungen, hochmotivierten Menschen im Austausch bin. In meinem eigenen Studium der internationalen Beziehungen in Genf konnte ich selbst erleben, wie viel engagierte und passionierte Professor:innen bewirken können. Richard Baldwin zeigte uns auf, wie wichtig ökonomische Überlegungen für soziale Fragen sein können. Marcelo Kohen brachte uns die Relevanz und Anwendungen des internationalen Völkerrechts nahe – eine Ausbildung, welche für mich bis heute in der Analyse von geopolitischen Entwicklungen hilfreich blieb. Und Najy Benhassine motivierte gleich mehrere von uns, ein Doktorat in Entwicklungsökonomie zu machen – d.h. in Wirtschaft für Länder mit tiefen und mittleren Einkommen. Ohne diese Mentoren wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin.
Deshalb freue ich mich immer, wenn ich Studierende für das Studium der Volkswirtschaft begeistern kann, und sie in ihrem Bestreben bestärken, einen positiven Beitrag für unsere Welt und unsere Gesellschaft zu leisten. Unsere Studierenden inspirieren mich sehr!
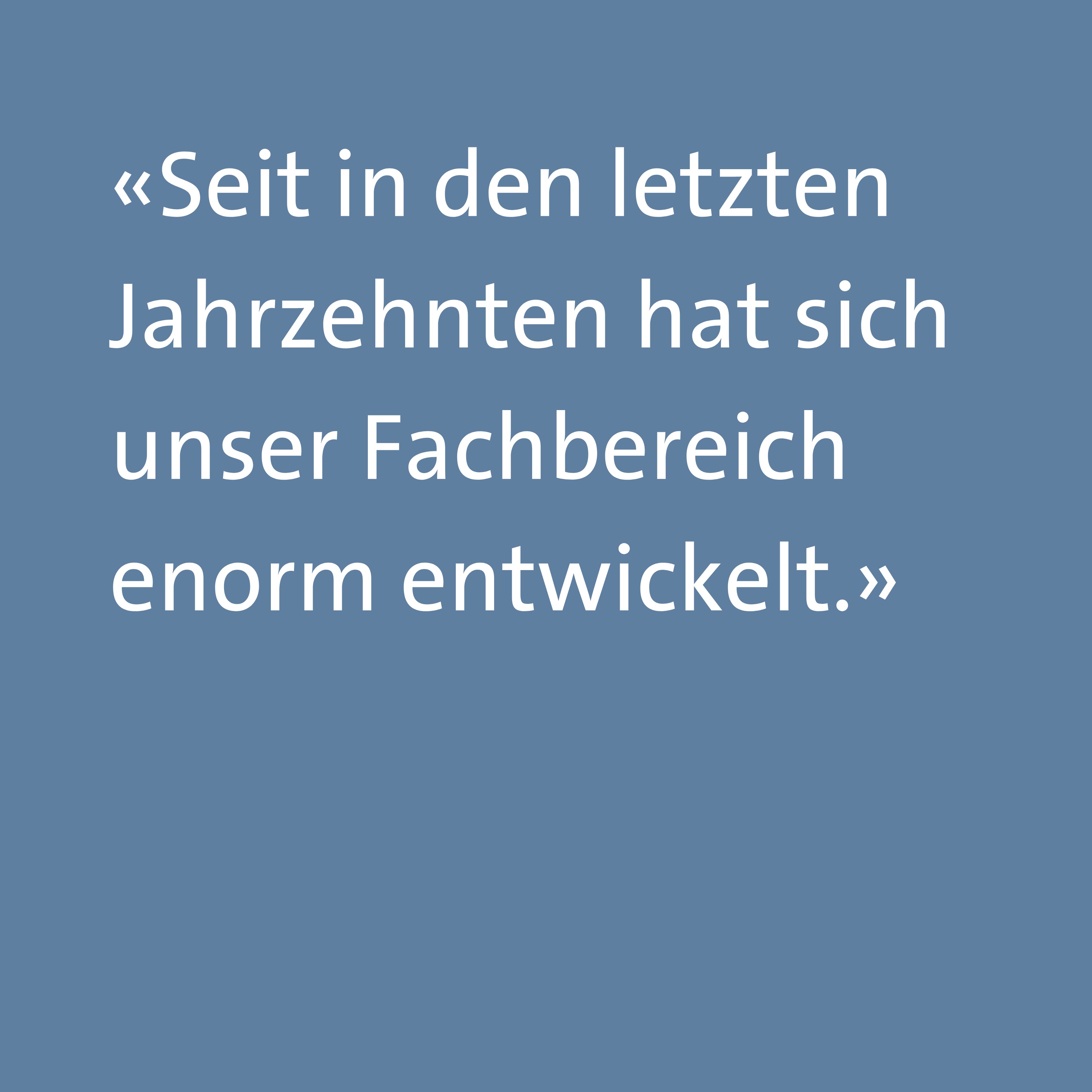
Welche Aspekte aus der Ökonomieforschung haben Sie besonders überrascht?
Pomeranz: Wie gesagt studierte ich ursprünglich nicht Wirtschaft, sondern internationale Beziehungen. Ich dachte, ein Wirtschaftsstudium sei nur etwas für Leute, die möglichst viel Geld verdienen wollten. Ehrlich gesagt kannte ich nicht einmal den Unterschied zwischen Betriebswirtschaftslehre (BWL) und Volkswirtschaftslehre (VWL). Auf Deutsch tönen diese beiden Fachbezeichnungen ja auch sehr ähnlich. Nicht so auf Englisch: BWL wird dort «Business» genannt. VWL heisst auf Englisch «Economics» und ist eine Sozialwissenschaft, die das Verhalten von Menschen, Organisationen und Märkten untersucht.
Je mehr ich über die aktuelle VWL-Forschung lernte, umso begeisterter war ich. In den letzten Jahrzehnten hat sich unser Fachbereich enorm entwickelt. Unter anderem dank der Verfügbarkeit immer besserer Daten und Methoden können wir komplexe Zusammenhänge heute viel differenzierter untersuchen und Entscheidungen stärker auf empirische Evidenz stützen - und weniger auf Ideologie.
In meiner Forschung untersuche ich Fragen wie die Wirkung von Entwicklungsprojekten, Bekämpfung von Steuerhinterziehung, Anreize für privates Sparen, Korruption in der öffentlichen Beschaffung, globale Armutsreduktion und Zugang zu grünen Technologien. Früher hätte ich niemals gedacht, dass all dies Themen sind, zu welchen die VWL einen Beitrag leisten kann.
Stossen Sie auch manchmal auf überraschende Befunde in Ihrer Forschung?
Pomeranz: Ja, immer wieder! Ein Beispiel dafür war ein Projekt mit der chilenischen Steuerbehörde. Nach dem Beitritt Chiles zur Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) führte das Land 2011 eine grosse Steuerreform durch, welche die Steuerhinterziehung von Grosskonzernen bekämpfen sollte. Diese haben meist Tochtergesellschaften in mehreren Ländern und können daher Profite gezielt in Niedrigsteuerländer verschieben, auch wenn diese gar nicht dort erwirtschaftet wurden (sogenanntes «Profit Shifting»).
Die Erwartung war, dass die Reform steuermotivierte Gewinnverschiebungen erheblich reduzieren und dadurch neues Steuereinkommen für das Land generieren würde. Unsere Daten zeigen jedoch, sowohl zur Überraschung von uns Forschenden als auch der Steuerbehörde, dass die Reform zu keiner Reduktion des Profit Shifting führte. Zuerst konnten wir das nicht verstehen. Um mehr Klarheit zu erlangen, führten wir viele vertiefte qualitative Interviews mit Expert:innen aus den betroffenen Firmen, der Steuerbehörde und aus Steuerberatungsfirmen. Aus diesen Gesprächen lernten wir: als Folge der Reform konsultierten viele multinationale Firmen vermehrt spezialisierte Steuerberatung, welche ihnen half, ihre internationalen Steuern noch weiter zu optimieren, anstatt in Chile mehr Steuern zu zahlen. Diese Hinweise aus qualitativen Interviews konnten wir anschliessend quantitativ mit Steuer- und Arbeitsmarktdaten bestätigen. Die Anzahl von Steuerberater:innen in diesem Bereich stieg in wenigen Jahren um das 10-fache!
Was haben Sie aus dieser Erfahrung mitgenommen?
Pomeranz: Dieses Forschungsprojekt bestätigte für mich drei grundsätzliche Dinge. Erstens, sorgfältige, kausale quantitative Wirkungsmessung ist enorm hilfreich, um Folgen von Politikentscheidungen verlässlich zu ermitteln, gerade auch dort, wo man intuitiv eine andere Wirkung erwarten würde. Zweitens, neben den Daten sind persönliche Gespräche und die lokale Expertise zentral. Ohne die Interviews mit den Expert:innen vor Ort wäre die Rolle der Beratungsfirmen vermutlich unentdeckt geblieben. Und drittens: Forschung kann manchmal so spannend sein wie eine Detektivgeschichte!
Sie haben seit diesem Jahr eine permanente Professur inne. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Meilenstein! Wo sehen Sie Ihre nächsten Schritte?
Pomeranz: Ich werde mich weiterhin prioritär auf meine akademische Forschung und die Lehre konzentrieren. Es gibt noch so viel Spannendes zu entdecken in der Forschung! Und in Bezug auf die Lehre freue ich mich, beim Ausbau unseres Angebotes im Bachelor und Masterbereich mitzuhelfen. Speziell auch für Studierende, die, wie ich ursprünglich, VWL im Nebenfach studieren.
Seit dem Bescheid, dass ich eine permanente Professur an der Uni Zürich erhalte, habe ich mich zudem entschieden, neben der Lehre auch vermehrt ausserhalb der Universität Einsichten aus der Forschung zu vermitteln. Als Professorin an einer öffentlichen Schweizer Universität sehe ich dies zum Teil auch als meine Pflicht. Einerseits versuche ich, vermehrt über VWL-Forschung zu kommunizieren, etwa in den Medien, an der Seniorenuniversität und im Rahmen verschiedener Veranstaltungen. Andererseits werde ich auch zunehmend von öffentlichen und privaten Institutionen um meine Expertise gebeten – sei es in beratenden Kommissionen des Bundesrates, im Parlament, oder in der Wirkungsmessung von Organisationen.
Insgesamt bin ich enorm dankbar, in diesem tollen Economics Department der Universität Zürich arbeiten zu dürfen.
Es bleibt spannend!
Das Interview führte Solenn Le Goff