Fünf Fragen für Thomas Graeber
Thomas Graeber ist der neue NOMIS Associate Professor of Cognitive and Neuroeconomics.

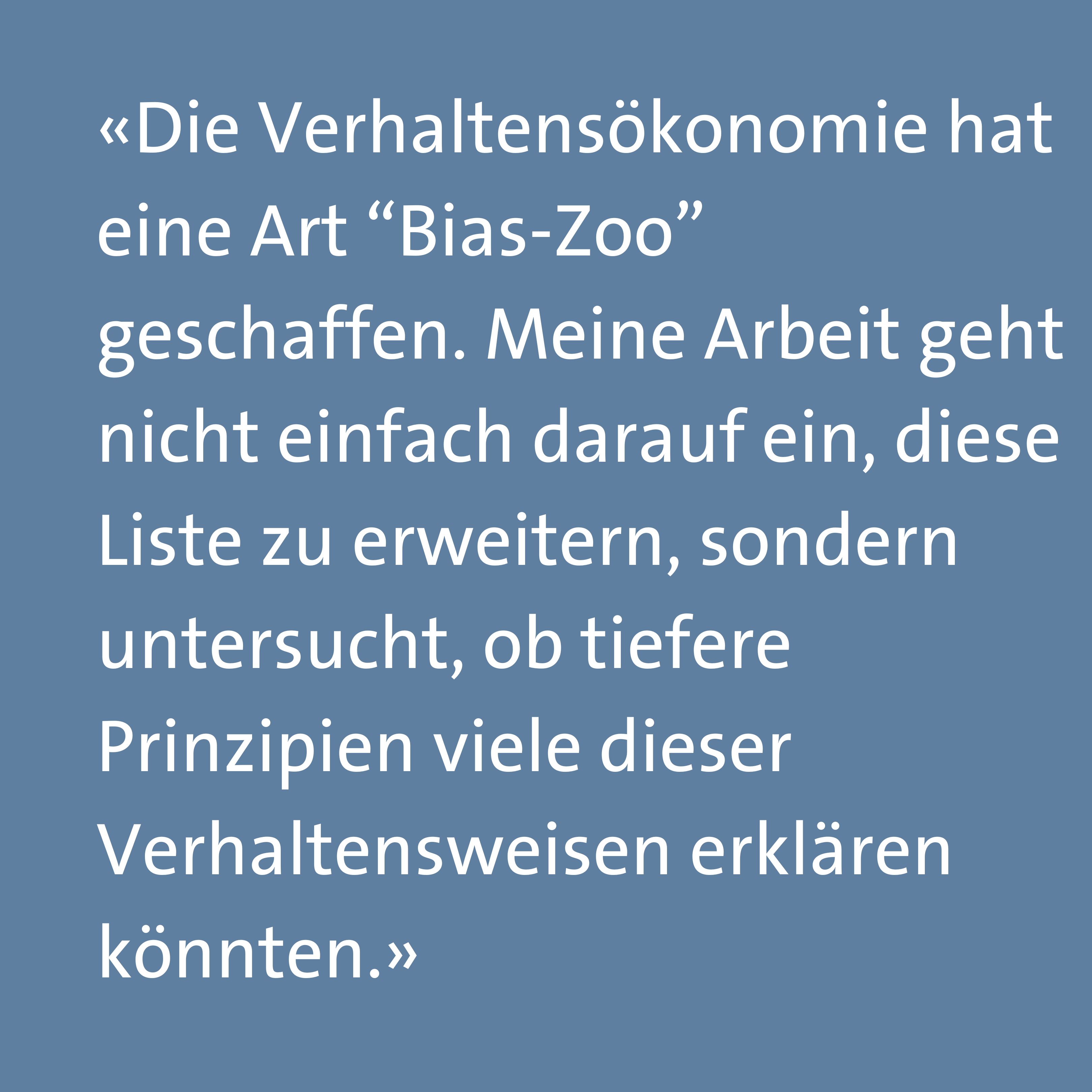
Können Sie uns sagen, woran Sie gerade arbeiten und was das Ziel Ihrer Forschung ist?
Die Verhaltensökonomie hat eine Art „Bias-Zoo“ geschaffen. Damit meine ich, dass wir viele verschiedene Wegen gefunden haben, wie Menschen Entscheidungen treffen, die nicht vollkommen rational sind, und die meisten davon werden separat untersucht. Meine Arbeit geht nicht einfach darauf ein, diese Liste zu erweitern, sondern untersucht, ob tiefere Prinzipien viele dieser Verhaltensweisen erklären könnten. Ein wiederkehrendes Rätsel in verschiedenen Bereichen ist, dass Menschen deutlich weniger auf Änderungen wichtiger Parameter reagieren, als ökonomische Modelle vorhersagen. Beispielsweise ändern sich Bewertungen von Lotterien nicht annähernd so stark, wie die Theorie es vorschlägt, wenn sich die Wahrscheinlichkeiten von 60 % auf 70 % oder 80 % ändern. Ebenso verändert sich die Zahlungsbereitschaft für eine spätere Zahlung nur wenig, egal ob die Verzögerung drei, vier oder fünf Jahre beträgt. Traditionell wurden diese und viele ähnliche Muster als separate Phänomene mit unterschiedlichen Erklärungen behandelt. In einer kürzlich veröffentlichten Studie zeigen wir, dass in jeder dieser Entscheidungen die meisten Menschen unsicher darüber sind, welche Wahl wirklich die beste ist. Denken Sie daran, wie viel Sie bereit wären, für ein Lotterielos zu zahlen, das mit 70 % Wahrscheinlichkeit 1.000 Franken auszahlt. Vielleicht sagen Sie 600 Franken, aber sind Sie sicher, dass es genau 600 sind? Nicht 550 oder 620? Wir argumentieren, dass diese Art von «kognitiver» Unsicherheit erklären kann, warum Entscheidungen oft weniger empfindlich reagieren auf Änderungen von Wahrscheinlichkeiten, Verzögerungen und anderen Entscheidungsparametern. Wenn Sie unsicher sind, was am besten ist, neigen Sie dazu ähnliche Situationen gleich zu behandeln.
Was ist das Hauptergebnis dieser Arbeit?
Im Rahmen von mehr als 30 experimentelle Settings – darunter Entscheidungen unter Risiko, über die Zeit, in prosozialen Kontexten, finanzielle Entscheidungen, Bildung von Überzeugungen, Prognosen, Strategiespiele und viele andere – finden wir, dass kognitive Unsicherheit darüber stark vorhersagt, was am besten ist. wie reaktionsschnell Menschen auf wichtige Entscheidungsparameter sind. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass viele scheinbar unterschiedliche Verhaltensweisen durch eine gemeinsame Perspektive neu interpretiert werden können: wie Menschen systematisch auf das Gefühl reagieren, unsicher über den richtigen Handlungsweg zu sein.
Gibt es eine weitere Arbeit von Ihnen, die Ihnen besonders am Herz liegt, die Sie erwähnen möchten?
Neben dem Beispiel, dass Menschen weniger reaktionsschnell sind, als die Standardtheorie vorhersagt, gibt es eine umfangreichere Fragestellung, die das Modell des homo oeconomicus nicht vorhersagt, nämlich die Reaktionsbereitschaft auf gewissen Faktoren. Insbesondere zeigen umfangreiche Nachweise die Rolle von Vergleichspunkten wie Zielen, Ankern, Referenzpunkten, Normen, Erwartungen und sozialen Vergleichen. In laufenden Arbeiten untersuchen wir die Idee, dass die Orientierung an diesen Vergleichspunkten teilweise ebenfalls die Unsicherheit darüber widerspiegelt, was optimal ist. Diese Perspektive hilft auch, die widersprüchlichen Erkenntnisse zu erklären, wann Vergleichspunkte dazu führen, dass Entscheidungen nach oben oder nach unten verschoben werden.
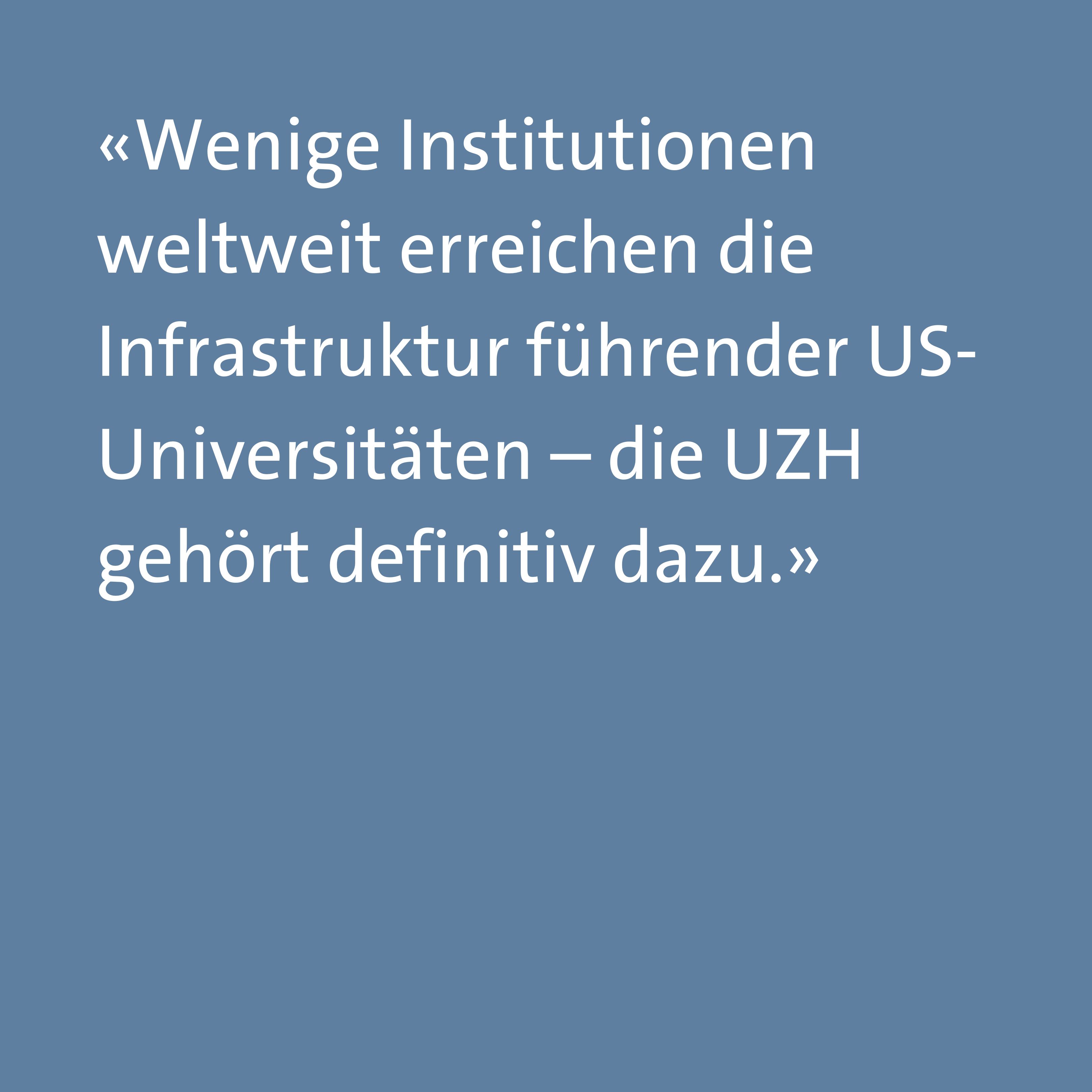
Sie haben vor kurzem eine Professur an der UZH angetreten. Was hat Sie dazu motiviert, nach Zürich zu kommen?
Die UZH verfügt über eine aussergewöhnliche Gruppe von Menschen in meinem Fachgebiet. Ich bin fest davon überzeugt, dass Forschung eine kollektive Anstrengung ist: Sie entsteht nicht allein in einem Raum, sondern durch ständige Interaktion mit Kolleg:innen und Studierenden. Neben den Menschen ist auch die Forschungsinfrastruktur entscheidend. Wenige Institutionen weltweit erreichen die Infrastruktur führender US-Universitäten – die UZH gehört definitiv dazu.
Wer ist die Inspiration hinter Ihrer Arbeit?
Ich würde nicht sagen, dass ich von Anfang an ein einziges Vorbild hatte. Im Laufe der Zeit habe ich jedoch erkannt, wie sehr vieles von dem, woran ich arbeite, mit Ideen von Herbert Simon übereinstimmt, die er vor Jahrzehnten erforscht hat. Zum Beispiel, als ich kürzlich daran arbeitete, wie Menschen komplexe ökonomische Probleme zerlegen, wurde mir klar, wie direkt dies auf Simons Überlegungen zu Kognition und Zerlegbarkeit aufbaut.
Aus dem Englischen übersetzt. Zu der Originalversion.