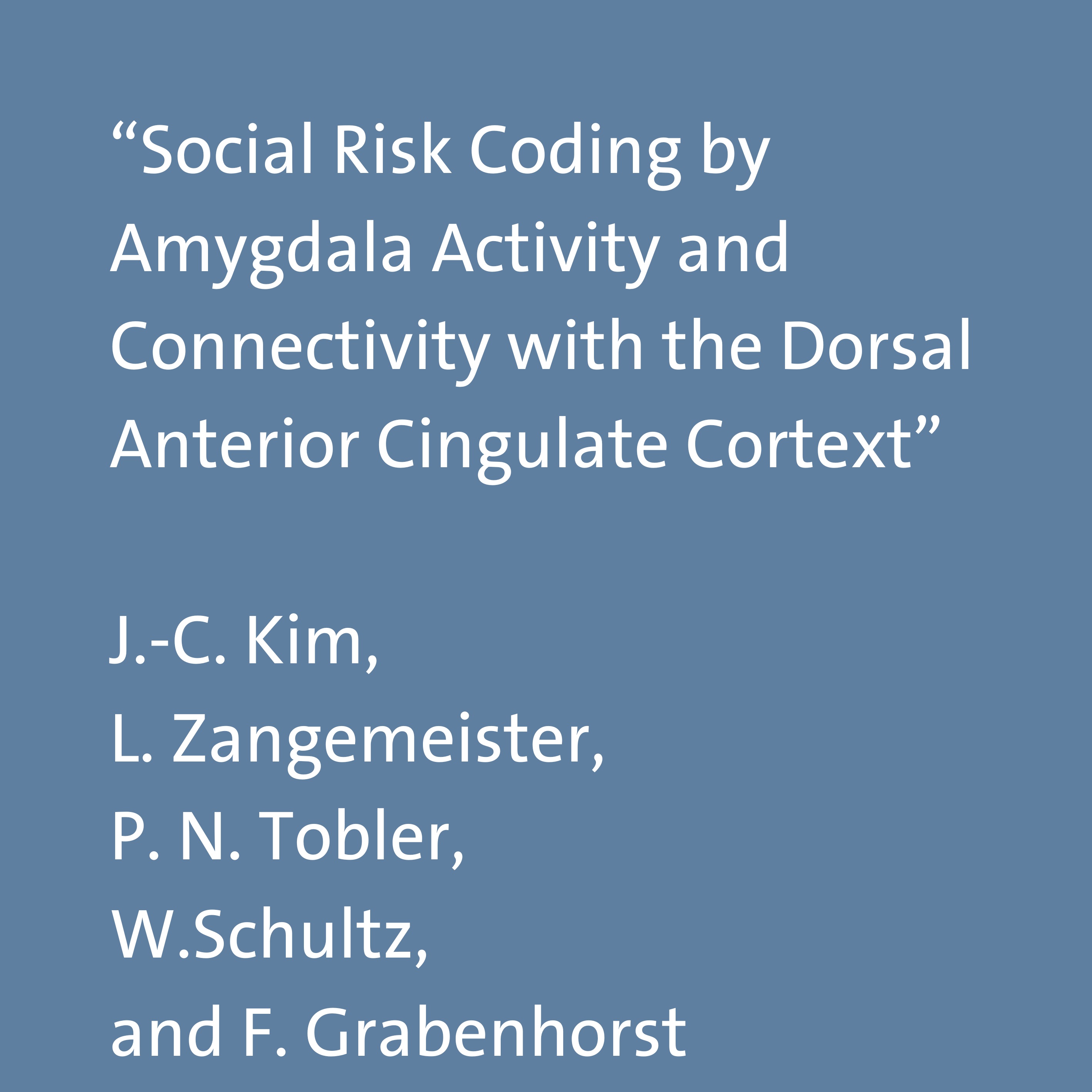Soziale Ängste: Wie unser Gehirn unsere Emotionen steuert
Hoffnung auf Anerkennung und Angst vor Zurückweisung sind Emotionen, die uns allen vertraut sind, wenn auch in unterschiedlicher Intensität. Doch warum ist das so?

Hoffnung auf Anerkennung und Angst vor Zurückweisung – auch als soziales Risiko bekannt – sind Emotionen, die uns allen vertraut sind, wenn auch in unterschiedlicher Intensität. Doch warum ist das so? Woher kommen diese Gefühle? Über die neuronalen Mechanismen, die soziale Risiken verarbeiten, ist bisher wenig bekannt.
Basierend auf Theorien aus der Finanz- und Wirtschaftswissenschaft haben Jae-Chan Kim, Philippe Tobler und Co-Autoren in einer aktuellen Studie (Journal of Neuroscience) die Konzepte des Risikos als Ergebnisvarianz sowie des subjektiven Werts von Gewinnen und Verlusten über finanzielle Kontexte hinaus erweitert. Sie untersuchten, wie das Gehirn die Varianz sowohl bei nicht-sozialen (z. B. Nahrungsbelohnungen) als auch bei sozialen (z. B. Komplimenten) nicht-monetären Belohnungen bewertet. Durch die Messung der Zahlungsbereitschaft der Individuen für diese Belohnungen unter variierendem Varianzrisiko erfassten sie individuelle Risikoeinstellungen.
Neuroimaging-Analysen zeigten, dass die Amygdala das tatsächliche Risikoniveau (objektives Risiko) kodiert – unabhängig davon, ob es sich um soziales oder nicht-soziales Risiko handelt. Doch bei der individuellen Wahrnehmung von Risiko (subjektives Risiko) spielt die Konnektivität zwischen der Amygdala und dem dorsalen anterioren cingulären Cortex – einer Region im Zentrum des Gehirns – eine entscheidende Rolle. Eine stärkere negative Kopplung zwischen diesen beiden Regionen war mit einer höheren Abneigung gegenüber sozialem Risiko verbunden. Somit bewerten zwar gemeinsame neuronale Schaltkreise die Ergebnisvarianz sowohl in sozialen als auch in nicht-sozialen Bereichen, jedoch wird die Verarbeitung sozialer Risiken stärker durch das Zusammenspiel von emotionsbezogenen (Amygdala) und kognitiven Kontrollbereichen (dorsaler anteriorer cingulärer Cortex) beeinflusst.
Die Daten deuten darauf hin, dass soziales Risiko – ähnlich wie finanzielles Risiko – den Prinzipien der Finanz- und Wirtschaftstheorie folgt. Die Studie beleuchtet die neuronalen Grundlagen des nicht-monetären Varianzrisikos und bietet eine Wissensbasis für Störungen, die mit einer veränderten Bereitschaft zur Eingehung sozialer Risiken einhergehen, wie beispielsweise soziale Angststörungen.