Navigation auf uzh.ch
Navigation auf uzh.ch

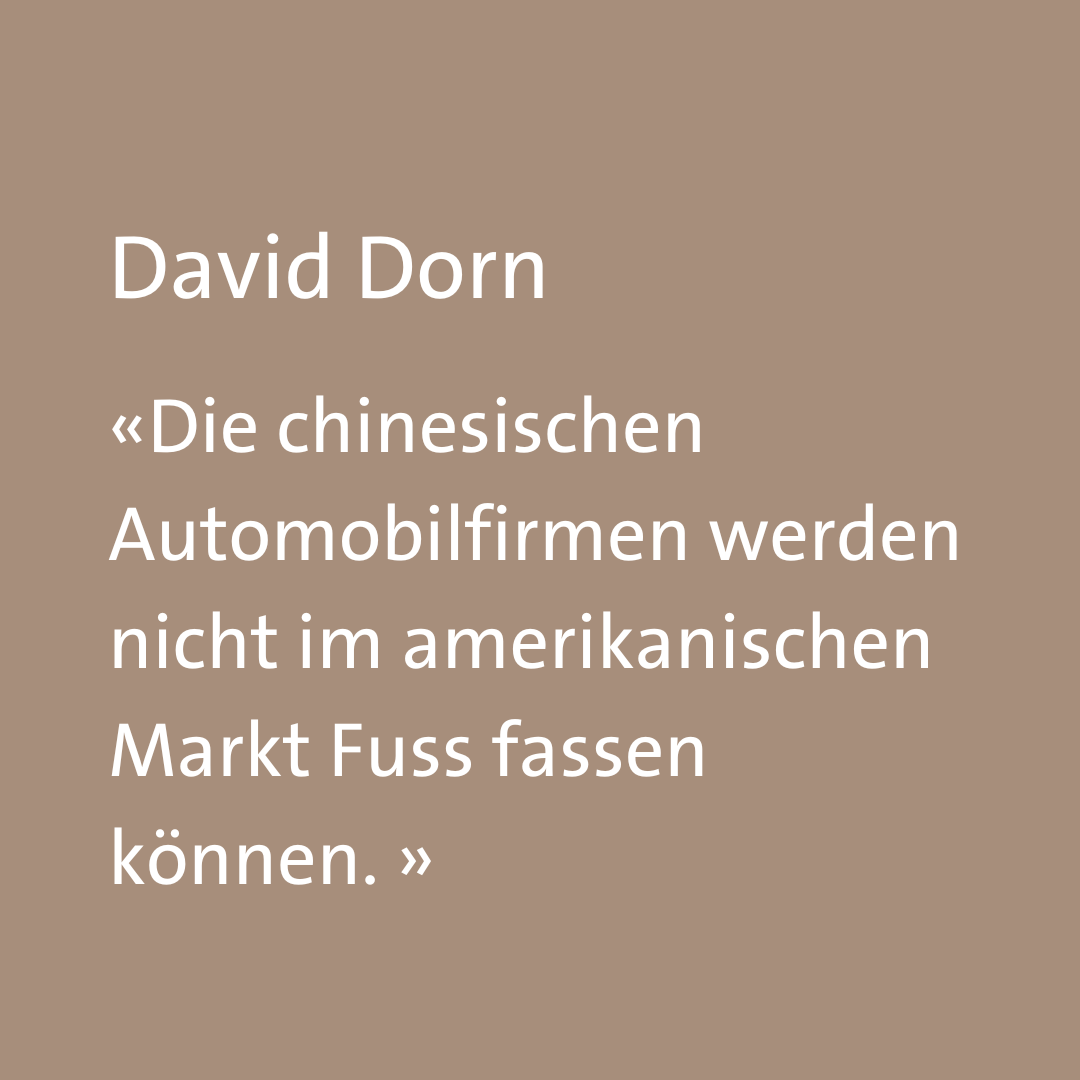
David Dorn: Die chinesischen Automobilfirmen werden nicht im amerikanischen Markt Fuss fassen können. In anderen Bereichen wie Batterien und Solarzellen werden die USA weiterhin Produkte aus China importieren, aber die amerikanischen Unternehmen und Konsumenten werden höhere Preise bezahlen müssen.
David Dorn: Nachdem die Amerikaner die chinesischen Automobilfirmen mit sehr hohen Zöllen faktisch vom US-Markt ausgeschlossen haben, werden die Chinesen ihre Exporte verstärkt auf Europa fokussieren. Die EU kann aber aus politischen und wirtschaftlichen Gründen nicht zulassen, dass die hiesige Automobilindustrie auf Grund der chinesischen Importkonkurrenz in Schieflage gerät, und führt deshalb ihrerseits Zölle ein.
David Dorn: Der Exportboom Chinas in den 1990er- und 2000er-Jahren trug dazu bei, dass in den Vereinigten Staaten wegen der grossen Importkonkurrenz innerhalb weniger Jahre Millionen von Arbeitsplätzen in der Industrie verloren gingen. Ökonomen haben die Auswirkungen dieses "China-
Schocks" lange unterschätzt.
David Dorn: Für Volkswirte ist der Effizienzgedanke traditionell sehr wichtig, Verteilungsfragen wurden dagegen lange vernachlässigt. Man ging davon aus, die volkswirtschaftlichen Effizienzgewinne des internationalen Handels seien gross genug, sodass die Gewinner die Verlierer einfach kompensieren könnten und am Schluss alle profitieren. Theoretisch ist das ein gutes Argument, doch tatsächlich werden die Verlierer oft nicht kompensiert.
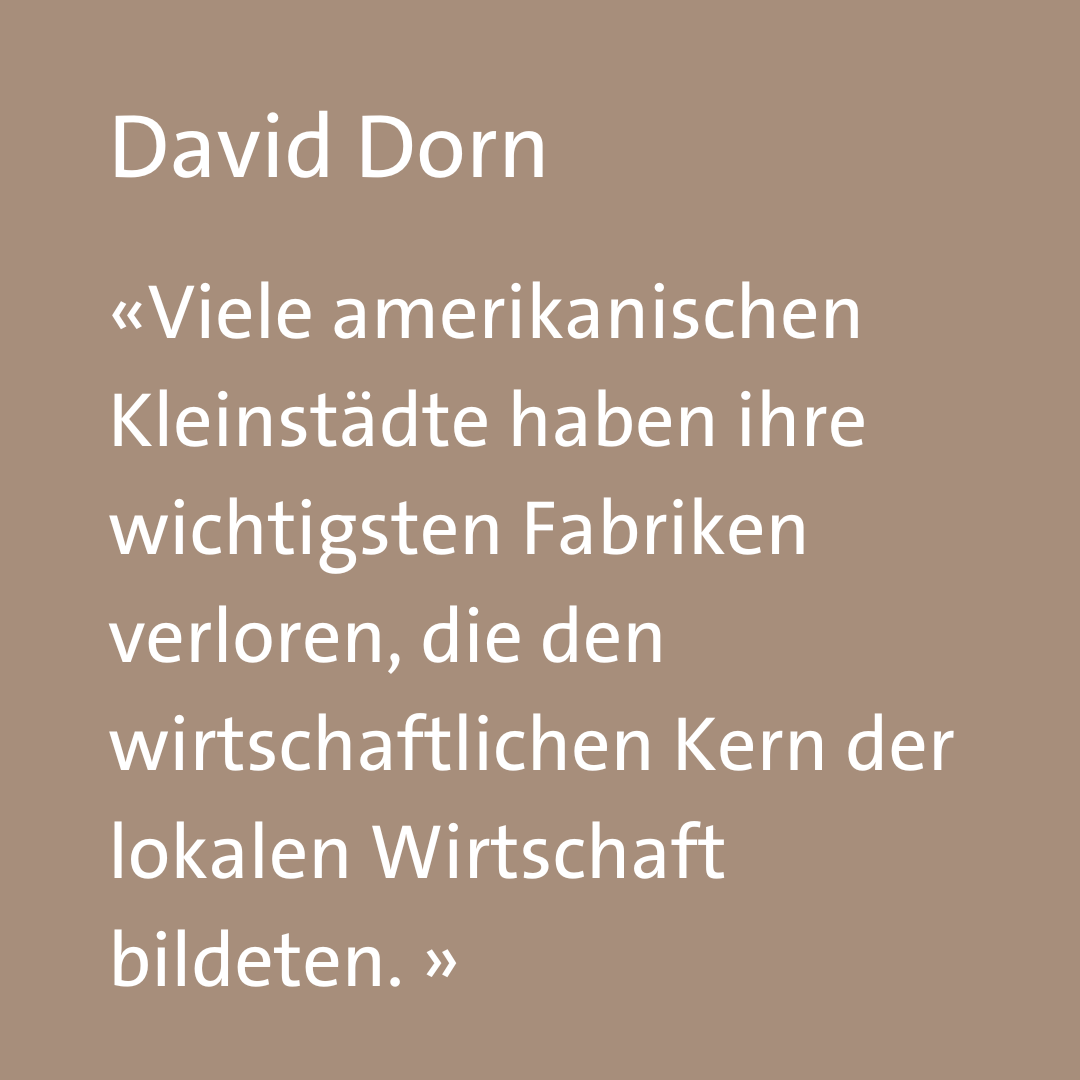
David Dorn: Viele amerikanischen Kleinstädte haben ihre wichtigsten Fabriken verloren, die den wirtschaftlichen Kern der lokalen Wirtschaft bildeten. Die Arbeitslosigkeit stieg rasant, die Kriminalität, der Alkohol- und Drogenmissbrauch ebenso. Auch viele Jahre nach den Fabrikschliessungen haben solche Orte weiterhin ein reduziertes Beschäftigungs- und Einkommensniveau.
David Dorn: Die chinesische Importkonkurrenz traf nur teilweise den bekannten "Rostgürtel", also die alten Industrieregionen um die grossen Seen herum, deren Automobil- und Stahlindustrie
schon vorher angeschlagen war. Besonders betroffen waren Gebiete, die südlich davon liegen, etwa North Carolina, Virginia, Tennessee und Kentucky.
David Dorn: Wegen der Branchenstruktur. Im weniger entwickelten amerikanischen Süden hatten sich vor Jahrzehnten Niedriglohn-Industrien angesiedelt. Im Wettbewerb um die kostengünstigste Produktion konnten sie mit China aber nicht dauerhaft mithalten. Das traf etwa Hersteller von Textilien, Lederwaren, Spielzeug, Möbel oder Heimelektronik. In manchen amerikanischen Kleinstädten war die Industrie ganz auf einen Sektor zugeschnitten. Die Kleinstadt Martinsville in Virginia war zum Beispiel fast vollständig auf die Möbelproduktion spezialisiert. Als Billigmöbel aus China auf den Markt kamen, musste dort aber eine Fabrik nach der anderen schliessen.
David Dorn: Ja, wir konnten zeigen, dass Donald Trump grössere Wahlerfolge verzeichnete in den Regionen, die besonders stark vom China-Schock betroffen waren.
David Dorn: Dahinter stand der Glaube, man könne verlorene Arbeitsstellen wieder zurückholen. Das funktioniert aber nicht. Wir haben untersucht, wie sich die Trump-Zölle ausgewirkt haben. Sie haben keine Arbeitsplätze zurückgeholt. Stattdessen gab es Gegenzölle der Chinesen auf amerikanische Exporte. Das hat die Situation verschlimmert.
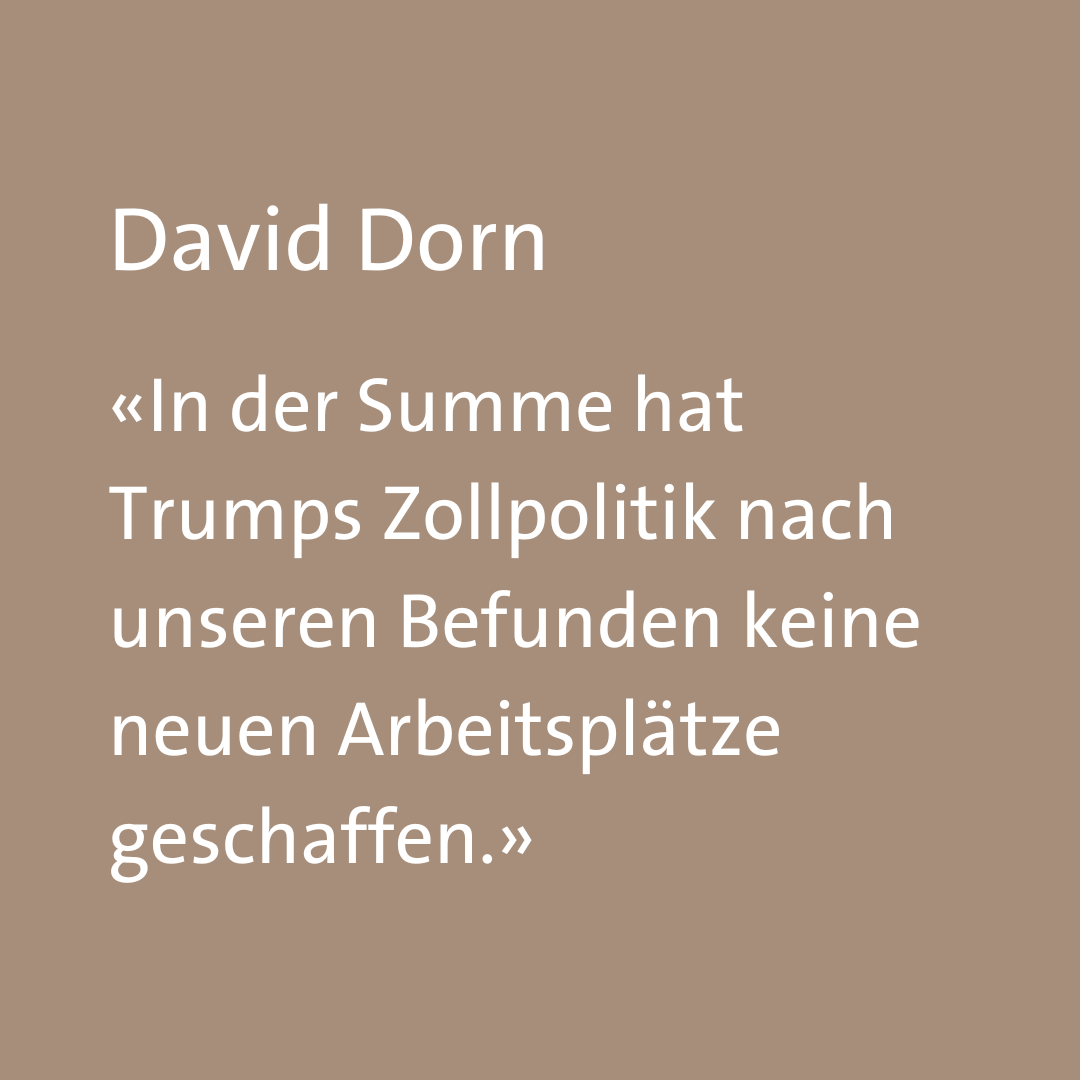
David Dorn: Die Gegenzölle zielten insbesondere auf die amerikanische Agrarwirtschaft. Betroffen
waren Landstriche, die vor allem auf Baumwolle und Sojabohnen spezialisiert sind. Daraufhin haben die Amerikaner ihre Agrarsubventionen erhöht. Diese konnten aber Jobverluste in der Landwirtschaft
nicht kompensieren. In der Summe hat Trumps Zollpolitik nach unseren Befunden keine neuen Arbeitsplätze geschaffen, aber aufgrund der verteuerten Importe sind die Preise für die amerikanischen Konsumenten gestiegen.
David Dorn: Ja, der China-Schock hat viele Amerikaner tiefgreifend verunsichert. Die Zölle gegen China sind in Amerika recht populär, obwohl sie wirtschaftlich nichts bringen. Politisch haben die Zölle Trump geholfen, er hat in den letzten Wahlen besser abgeschnitten in Regionen, deren Branchen Zollschutz erhalten haben. Auch Joe Biden hat danach die Zölle gegen China nie aufgehoben und vor Kurzem sogar neue Zollerhöhungen angekündigt. Auch die Demokraten haben erkannt, dass die Zölle auf chinesische Produkte im Volk sehr populär sind, trotz ihrer fragwürdigen
wirtschaftlichen Auswirkungen.
David Dorn: Ich habe dazu zwei Hypothesen: Die eine ist, dass die Regierung Trump ihre Zollpolitik
so dargestellt hat, als hätte sie jede Menge Jobs geschaffen. Mit anderen Worten: Manche Wähler sind der faktenwidrigen Regierungspropaganda auf den Leim gegangen. Interessant ist allerdings, dass
es gemäss Umfragen durchaus auch republikanische Wähler gibt, welche die Trump-Zölle unterstützen obwohl sie diese als wirtschaftlich nachteilig für die USA einstufen. Meine zweite Hypothese ist deshalb, dass manche Wähler den geringen wirtschaftliche Nutzen der Zölle verstehen, gleichzeitig aber honorieren, wenn die Regierung ein Zeichen zur Unterstützung der verarmten Industriestädte setzt und gegen den Konkurrenten China vorgeht. Viele sehen die Zollpolitik als eine gut gemeinte Massnahme, die zwar wirtschaftlich nicht besonders erfolgreich war, aber immerhin auch China geschadet hat.
FAZ: Biden führt Trumps Zollpolitik fort. Er hat Trumps Zölle im Wesentlichen beibehalten und sattelt jetzt noch obendrauf...
David Dorn: Die amerikanische Handelsministerin sagte schon länger, die Beibehaltung der Zölle sei im strategischen Interesse der USA. Biden ist sich wohl bewusst, dass ein Aufheben von Trumps Zöllen im Wahlkampf als Zeichen der Schwäche gegenüber China ausgeschlachtet würde. Mit den kürzlich angekündigten neuen Zöllen versucht Biden im Gegenteil, Stärke gegenüber China zu demonstrieren und sich als Verteidiger von amerikanischen Industriejobs zu positionieren.
FAZ: Unterscheidet sich die Industriepolitik Bidens noch von derjenigen Trumps?
David Dorn: Trump hat neue Zölle auf fast alle chinesischen Produkte eingeführt. Biden konzentriert
seine Wirtschaftspolitik dagegen stärker auf Schlüsseltechnologien. Dabei versuchen die Amerikaner einerseits, China von gewissen Technologien wie etwa modernsten Computerchips abzuschneiden.
Und andererseits arbeitet Amerika daran, von China unabhängig zu werden, indem insbesondere Branchen im Bereich der grünen Technologien durch gezielte Subventionen gefördert werden.
FAZ: ... über den sogenannten Inflation Reduction "Act"...
David Dorn: ... der trotz des irreführenden Namens eigentlich ein grosses Subventionspaket für die amerikanische Wirtschaft ist.
FAZ: Seither ist rund um die Welt ein gigantischer Subventionswettlauf in Gang gesetzt worden. Wo führt das hin?
David Dorn: Durch die amerikanischen Subventionen sind auch die EU-Staaten stark unter Zugzwang
gekommen. Das ist schmerzhaft für Europa. Die EU hat sich eigentlich zum Ziel gesetzt, dass es keine Subventionswettläufe zwischen den Nationen geben soll. Weil die europäischen Schlüsselindustrien jetzt unter Druck geraten - etwa die deutsche und französische Automobilindustrie -, kommen auch in Europa Rufe nach höheren Subventionen auf, solange die ausländischen Konkurrenten ihre entsprechenden Branchen mit hohen Subventionen stützen.
FAZ: Auch wir Deutschen versuchen, mit Milliardensubventionen Unternehmen wie Intel anzulocken. Was halten Sie davon?
David Dorn: Das halte ich für sehr riskant. Der Subventionswettlauf, der gerade einsetzt, ist in diesem Ausmass eine wirklich neue Entwicklung. Der Aufbau einer eigenen Chipindustrie verschlingt sehr hohe Fixkosten, es geht um gigantische Summen. Gleichzeitig veralten Chips sehr schnell, denn die
technologische Entwicklung verläuft rasant. Es besteht die Gefahr, dass viel Geld in ein Produkt investiert wird, das bald wieder obsolet werden könnte.
FAZ: Die Politik treibt die Hoffnung, dass sich mit viel Geld ein solches Biotop aufbauen lässt, aus dem dann immer wieder Neues gedeihen soll. Zu Recht?
David Dorn: Ein Innovationscluster wie das Silicon Valley lässt sich nicht so einfach nachahmen.
Das haben schon viele versucht. Es braucht ein Zusammenspiel von vielen verschiedenen Elementen: Forschung in Spitzenuniversitäten, gut verfügbare Risikokapitalgeber, hoch qualifizierte Arbeitnehmer und vieles mehr, damit so etwas entstehen kann.
FAZ: Der Freihandel hat es schwer in den letzten Jahren.
David Dorn: Ja. Die Zölle sind ein enormer Bruch. Wir waren jahrzehntelang auf dem Weg hin zu mehr Freihandel. Sowohl die Zölle als auch der jüngste Subventionswettlauf sind eine Kehrtwende gegenüber der vorangegangenen Entwicklung zu einer immer freieren und globaleren Weltwirtschaft.
FAZ: Und ausgelöst wurde dies alles durch den China-Schock?
David Dorn: In der Tat. China hat sich vorgenommen, mit staatlicher Hilfe Industrien aufzubauen
und in Schlüsseltechnologien zu dominieren. Amerika und Europa werfen China schon seit Jahren vor, seine Industrie mit unzulässigen Subventionen zu unterstützen. Man hat lange versucht, China dazu zu bewegen, von solchen Praktiken Abstand zu nehmen. Mittlerweile aber hat sich die Dynamik stark verändert. Amerika und Europa setzen China jetzt eigene Subventionen und Handelsschranken entgegen - obwohl die eigentlich als unerwünscht eingestuft werden. Die breite Front der Unterstützer des Freihandels ist erodiert.
.png)
David Dorn ist UBS Foundation Professor of Globalization and Labor Markets am Department of Economics. Er gehört zu den 100 meistzitierten Ökonomen weltweit in den letzten zehn Jahren. Im Jahr 2023 wurde ihm der Hermann-Heinrich-Gossen-Preis für den erfolgreichsten Ökonomen im deutschsprachigen Raum unter 45 Jahren verliehen.
Veröffentlichung mit Genehmigung
"Amerikas zweifelhafte Zölle" (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 03.06.2024, S. 16, Tillmann Neuscheler).
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt. Zur Verfügung gestellt vom Frankfurter Allgemeine Archiv.