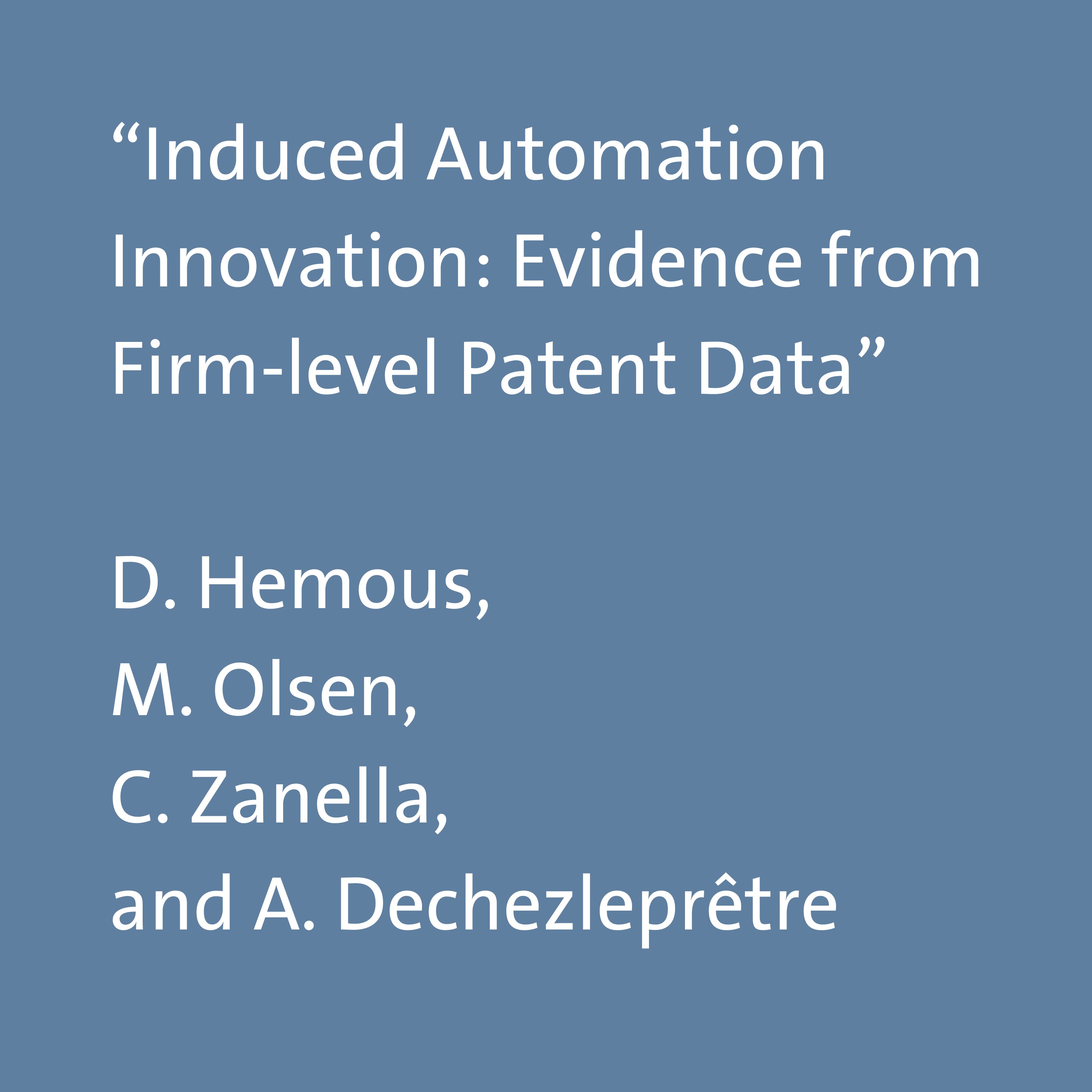Der Zusammenhang zwischen Lohn und Innovation: Neue empirische Erkenntnisse
David Hémous und seine Co-Autoren haben vor Kurzem eine Studie veröffentlicht, die neue empirische Belege für den Zusammenhang zwischen Lohn und Innovation liefert.
(38).jpg)
Steigende Löhne treiben die Innovation im Bereich der Automatisierungstechnologie voran, da Unternehmen nach kostensparenden Innovationen suchen, um teure Arbeitskräfte zu ersetzen – so besagt es die gut dokumentierte ökonomische Theorie. Doch wie sieht die Realität aus? Treiben Unternehmen tatsächlich Automatisierungsinnovationen voran und setzen sie um, wenn sie externem Druck wie steigenden Löhnen ausgesetzt sind? Während die theoretische Evidenz gut belegt ist, fehlte es bislang an überzeugenden empirischen Nachweisen. In ihrer neuen Studie liefern David Hémous, UBS Foundation Associate Professor of Economics of Innovation and Entrepreneurship, und seine Koautoren* nun starke empirische Belege, die diese Annahme bestätigen.
Ein innovativer Ansatz
Für ihre Untersuchung verfolgten die Autoren einen innovativen Ansatz, indem sie zwei unterschiedliche Datensätze kombinierten. Der erste Datensatz basiert auf einer neu entwickelten Klassifikation von Automatisierungspatenten, die auf europäischen Patentdaten beruht. Im Gegensatz zu früheren Studien, die sich hauptsächlich auf die Einführung bestehender Technologien konzentrierten, messen die Autoren hier Automatisierungspatente als direkten Indikator für technologische Innovation. Dadurch wird es möglich, die Innovationsaktivitäten von Unternehmen zu analysieren, indem automatisierungsbezogene Patente auf Unternehmensebene analysiert werden.
Dieser Patentdatensatz wurde anschliessend mit einem makroökonomischen Datensatz kombiniert, der 41 Länder umfasst und sich auf innovative Unternehmen konzentriert, die globalen Marktkräften ausgesetzt sind. Dieser wurde genutzt, um Lohnniveaus zu berechnen. Durch die Verknüpfung dieser beiden Datensätze konnten die Forscher untersuchen, wie Lohnschwankungen Innovationen im Bereich der Automatisierung auf Unternehmensebene beeinflussen. Dieser methodische Ansatz erlaubt es, den kausalen Einfluss der Arbeitskosten auf technologische Fortschritte herauszuarbeiten und liefert eine präzisere Analyse der Unternehmensreaktionen auf Lohnveränderungen.
Arbeitsmarktpolitik und ihre unbeabsichtigten technologischen Folgen
Die Studie analysiert zudem frühere Arbeitsmarktreformen und deren Auswirkungen auf Innovationstrends und bestätigt dadurch die zugrunde liegende Annahme. Die Forscher zeigen, dass höhere Mindestlöhne Unternehmen dazu veranlassen, verstärkt Automatisierungstechnologien zu entwickeln. Umgekehrt führte die deutsche „Hartz“-Reform – eine tiefgreifende arbeitsmarktpolitische Reform, die zwischen 2003 und 2005 umgesetzt wurde und die Löhne senkte – zu einem Rückgang der Automatisierungsinnovationen unter Unternehmen, die dem deutschen Markt ausgesetzt waren. Diese Ergebnisse verdeutlichen, wie Arbeitsmarktpolitiken direkt die Anreize von Unternehmen beeinflussen, in Automatisierung zu investieren – oder eben nicht –, und so langfristige Innovationsentwicklungen massgeblich prägen.
Starke empirische Evidenz und Ausblick
Die Studie liefert überzeugende empirische Belege dafür, dass steigende Löhne für geringqualifizierte Arbeitskräfte die Automatisierungsinnovation fördern: Ein Lohnanstieg um 1 % führt zu einer Zunahme der Automatisierungsinnovation um 2% bis 5%.
Umgekehrt führt ein Anstieg der Löhne für hochqualifizierte Arbeitskräfte zu einer geringeren Innovationsaktivität im Automatisierungsbereich, da der Betrieb und die Implementierung von Automatisierungstechnologien oft hochqualifiziertes Personal erfordern. Bemerkenswert ist, dass die Forscher beobachten, wie andere Innovationsbereiche – beispielsweise Verbesserungen der Energieeffizienz – nicht auf Lohnschocks reagieren.
Politische Massnahmen wie Mindestlohnerhöhungen oder die deutschen „Hartz”-Reformen verdeutlichen, dass Arbeitsmarktpolitiken technologische Entwicklungen und langfristige wirtschaftliche Dynamiken, wie das Wirtschaftswachstum, beeinflussen. Darüber hinaus regen die Autoren weitere Forschung an, inwieweit steigende Löhne für hochqualifizierte Arbeitskräfte die Entwicklung neuer Automatisierungstechnologien insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) begünstigt haben könnten.